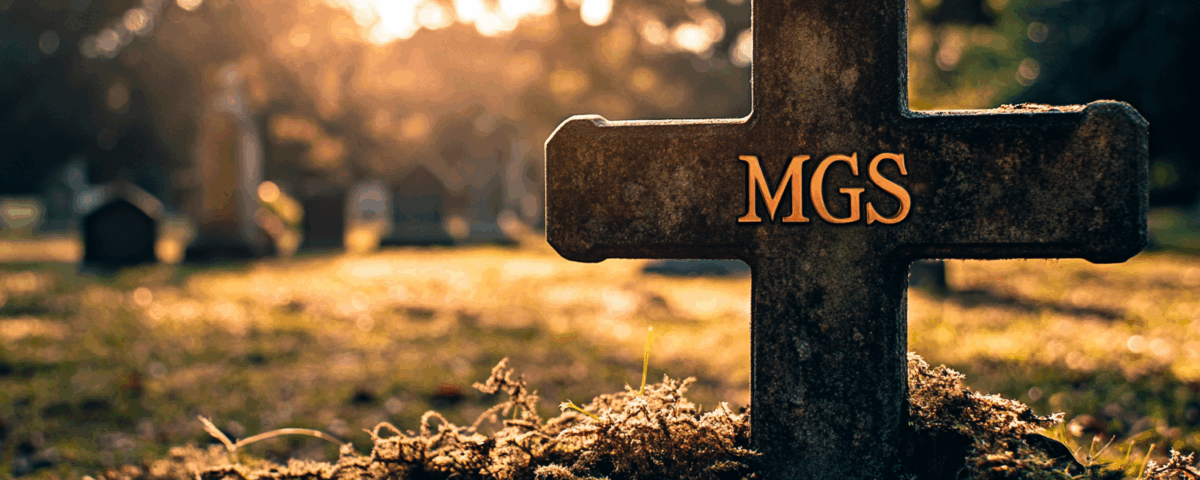Newsletter – Mai 2025
24. Mai 2025Newsletter - Juni 2025

Vorsicht: MGS!
Liebe Leserin, lieber Leser,
heute werden wir uns zum dritten und letzten Mal dem Thema des Neinsagens widmen. Bevor wir das tun, gibt es aber erfreuliche interne Nachrichten zu verkünden. Aus https://self-management.science/ wird das ISM Institut für Selbstmanagement GmbH. Wir befinden uns mit den Themen des Selbstmanagements also gerade mitten in der Unternehmensgründung.
Aufgrund des Umbaus und der sehr zeitaufwändigen Gründungsaktivtäten machen wir nach dieser Ausgabe eine kleine Newsletterpause. Wir hoffen aber, dass wir schon sehr bald wieder für Sie zur Stelle sein können.
Nun aber zurück zum Thema! Heute sehen wir uns an, warum es gefährlich werden kann, wenn man Menschen eine kleine Bitte erfüllt. Wir sehen uns ferner an, wie sie eine Bitte ablehnen können, ohne überhaupt „Nein!“ sagen zu müssen. Und schließlich sehen wir uns an, was es bedeutet, wenn man allen immer gefallen möchte.
Schön, dass Sie auch im Juni wieder dabei sind!

Ihr Prof. Dr. Stefan Winter

Ihr Dr. Robin Matz
Wehret den Anfängen!
Vor knapp 60 Jahren ist ein wissenschaftlicher Aufsatz in einer psychologischen Fachzeitschrift erschienen, der als einer ersten den sogenannten „Fuß-in-der-Tür-Effekt“ untersucht hat.

Jonathan Freedman und Scott Fraser haben in dem Aufsatz ein Experiment beschrieben, mit dem sie herausbekommen wollten, wie man Menschen dazu bringen kann, einer größeren Bitte nachzukommen. Dazu hatten Jonathan und Scott die Teilnehmer des Experiments in zwei Gruppen eingeteilt. Die Mitglieder der einen Gruppe wurden direkt mit einer größeren Bitte konfrontiert. Sie wurden telefonisch gefragt: „Dürfen 5 bis 6 Mitarbeiter unseres Marktforschungsinstituts ca. 2 Stunden ihre Schränke und Regale durchsehen, um sämtliche Marken der von Ihnen verwendeten Produkte zu erfassen? Das Ziel ist die Erstellung eines Markenführers einer Verbraucherorganisation.“ Würden Sie das bei sich zu Hause erlauben?

Die Mitglieder der anderen Gruppe wurden zunächst um eine Kleinigkeit gebeten: Sie wurden gebeten, nur acht harmlose Marktforschungsfragen zu beantworten. Etwa die Frage nach dem Namen des verwendeten Spülmittels. Die große Bitte mit dem zweistündigen Hausbesuch durch ein Marktforschungsteam wurde erst drei Tage später gestellt.
Das faszinierende Ergebnis: Von denen, die zunächst per Telefon die Marktforschungsfragen beantwortet haben, sind anschließend 53% auch der größeren Bitte drei Tage später nachgekommen. Von denen, die gleich mit der größeren Bitte konfrontiert wurden, sind hingegen nur 22% dieser Bitte nachgekommen. Genau dieses Phänomen bezeichnet den Fuß-in-der-Tür-Effekt: Wenn Menschen bereits einmal geholfen haben, fällt es ihnen schwerer, zukünftige Bitten abzulehnen. Dieser Effekt ist in den letzten 60 Jahren immer wieder bestätigt worden.
Rosanna Guadagno und ihre Koautorinnen gehören zu denen, die den Fuß-in-der-Tür-Effekt ebenfalls bestätigen. Sie decken aber noch weitere Hintergründe auf. Zum Beispiel finden die Autorinnen einen Konsistenzeffekt. Menschen, die ein starkes Bedürfnis haben, nach außen immer gleich, also konsistent, aufzutreten, sind besonders anfällig für den Effekt. Der Fuß-in-der-Tür-Effekt wird zudem verstärkt, wenn man Menschen vor einer erneuten Bitte daran erinnert, dass sie in der Vergangenheit bereits geholfen haben. Das machen sich zum Beispiel gemeinnützige Organisationen zu Nutze, indem sie sich für die letzte Spende bedanken („Erinnerung!“) und dann gleich um die nächste bitten.
Zu einer guten persönlichen „Neinkultur“ gehört daher, sich der psychischen Fallen des Fuß-in-der-Tür-Effekts bewusst zu sein. Seien Sie also auch auf der Hut vor den kleinen Gefallen. Die werden schnell zu großen Füßen in Ihrer Tür. Sie könnten z.B. bei Menschen, die neu in Ihr Leben treten, wie z.B. die neue Kollegin oder der neue Nachbar, etwas zurückhaltender agieren!
Quellen:
Freedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: the foot-in-the-door technique. Journal of personality and social psychology, 4(2), 195-202.
Guadagno, R. E., et al. (2001). When saying yes leads to saying no: Preference for consistency and the reverse foot-in-the-door effect. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(7), 859-867.
Einen Moment mal!
Die Überschrift dieses Artikels beschreibt vielleicht schon die vollständige Lösung eines Problems! Wir hatten in den vorangehenden Ausgaben berichtet, dass das „Ja!“-Sagen auf eine Bitte oft eine viel zu schnelle Kurzschlusshandlung ist. Wer aus der Falle des ständigen Jasagens entkommen will, muss lernen, Pausen zu machen, Pausen auszuhalten und Pausen zu nutzen. Pausen kann man nicht nur im Garten machen, sondern auch im Gespräch!

Der Vorteil einer kurzen Pause ist, dass man Zeit hat, sich die tatsächlichen Konsequenzen zu überlegen. „Kannst Du mir beim Umzug helfen?“ Was soll man darauf antworten? Wenn man die Frage spontan bejaht, dann hat man sich ggf. drei Tage harte Arbeit und sechs Wochen Rückenschmerzen eingehandelt. Daran denkt man aber erst, wenn man in Ruhe nachdenkt.
Sara Bögels, Kobin Kendrick und Stephen Levinson haben aber noch einen ganz anderen Vorteil der Pause gefunden. Man könnte auch sagen: Einen genialen Trick. Die Autoren stellen zunächst fest, dass sehr schnelle Ablehnungen einer Bitte als besonders unhöflich und grob empfunden werden. Stellen Sie sich vor, dass Sie jemanden um etwas bitten möchten und das läuft dann so ab. „Könntest Du mir vielleicht…“ „Nein!“. Das „Nein!“ grätscht Ihnen schon rein, ehe Sie Ihre Bitte ganz ausgesprochen haben. Wie würden Sie sich mit einer solchen Reaktion fühlen?
Und nun passiert aber etwas Faszinierendes. Da Menschen dazu neigen, ihre Zustimmung sehr schnell zu äußern, interpretieren sie Verzögerungen als mögliche Ablehnungen. Das Schöne daran: Diese Interpretationen machen es Menschen leichter, ein „Nein!“ zu akzeptieren. Oder, und das ist das Beste: Aus der Verzögerung schließt der Bittsteller bereits, dass er ein Nein kassieren wird. Mit ein wenig Glück sagt er dann selbst so etwas wie „Oh, ich sehe schon, es passt grad nicht!“ oder „Sorry, kann ich eigentlich auch selbst erledigen!“. In diesem Fall muss man das „Nein!“ nicht einmal aussprechen, die Pause allein reicht, um aus der Nummer rauszukommen. Sie müssen das „Nein!“ bloß denken, mehr ist nicht mehr nötig!

Jetzt kommt es aber noch besser: Da nach einer längeren Pause ohnehin eine Ablehnung erwartet wird, wirkt eine Zusage noch positiver als hätte man sofort zugestimmt. Stellen Sie sich das so vor: Sie werden gefragt „Könntest Du mir beim Umräumen der Akten helfen?“ Pause. Sie räuspern sich: „Ähm…“. Dann kommt der Satz ihres Gegenübers: „Sorry, blöde Frage, kann ich auch allein machen“. Und jetzt sagen Sie „Ne, ne, war nur gerade irgendwie in Gedanken, mache ich doch gern, klar helfe ich Dir.“ Jetzt ist das Jasagen plötzlich eine positive Überraschung. Und wer freut sich über Überraschungen nicht mehr als über Selbstverständlichkeiten?

Legen Sie sich am besten ein paar Pausenfüller zu. Ein langgezogenes „Ähmmmmmmm…“ kann schon reichen, vielleicht ist aber auch ein „Ups, lass mich bitte kurz überlegen…“ nicht schlecht. Kurz gesagt: Werden Sie Antwort-Verzögerungs-Spezialist, das schafft Ihnen einiges an Lasten vom Hals!
Quellen:
Bögels, S., Kendrick, K. H., & Levinson, S. C. (2015). Never say no… How the brain interprets the pregnant pause in conversation. PloS one, 10(12), e0145474.

MGS: Das Menschengefaller-Syndrom!
Das Menschgefaller-Syndrom werden Sie in keinem Gesundheitslexikon finden. Und dennoch ist es ein sehr weit verbreitetes Krankheitsbild, auch wenn es kein offiziell anerkanntes ist. Wie bei allen Krankheiten führt auch das MGS zu Symptomen, über die man es diagnostizieren kann. Wer vom MGS befallen ist, kann a) schwer „Nein!“ sagen, b) braucht ständig Zuspruch und Anerkennung von außen, c) fürchtet sich vor Ablehnung, d) vernachlässigt sich selbst zugunsten anderer, e) geht Konflikten lieber aus dem Weg, f) neigt zum Perfektionismus und g) entschuldigt sich sogar für Dinge, die andere falsch gemacht haben. Wer mehr als 3 dieser Symptome aufweist, der dürfte wohl vom MGS befallen sein. Kennen Sie so jemanden? Darauf sollten Sie mit Mitgefühl reagieren, denn die vom MGS befallenen Menschen leiden erheblich.

Gibt es Heilung? Ja, in der Tat, die gibt es! Ein erfolgversprechender Ansatz besteht darin, an der Behandlung der Symptome anzusetzen. Gewöhnlich sind reine Symptomtherapien eher nicht erfolgreich, aber beim MGS ist das anders. Den Therapie-Ansatz zur Behandlung des ersten Symptoms haben wir in unserer Newsletter-Reihe zum Neinsagen intensiv besprochen. Da die Unfähigkeit, auch mal „Nein!“ zu sagen, eines der schwerwiegendsten Symptome ist, besteht ein guter Therapieansatz darin, das Neinsagen Stück für Stück einzuüben.
Für die Therapieansätze aller Symptome gilt aber eine wichtige Merkregel: Langsam gewinnt! Menschen, die sich vor Ablehnung fürchten, können diese Furcht nicht mit einer einmaligen Spontanaktion beseitigen. Ebenso wenig lässt sich Selbstvernachlässigung von heute auf morgen beseitigen. Gerade bei diesem Thema bietet sich aber auch ein guter Therapieansatz. Selbstvernachlässigung kann man schrittweise zurückfahren. Z.B. indem man sich Zeiten nur für sich selbst nimmt und sich zu diesem Zeiten äußerst pfleglich behandelt. Das kann im Winter ein heißes Bad bei sanfter Musik und Kerzenschein sein oder das Glas Rosé auf der Terrasse des Gartenlokals am See im Sommer.

Selbstfürsorge kann auch das gesunde Frühstück sein, dass man zur Abwechslung mal wirklich in Ruhe isst. Oder das Ausschalten des Handys für ein paar Stunden. Das MGS ist keine Verurteilung auf Lebenszeit!. Es ist aber eine ernste Erkrankung, die behandelt werden sollte.
In der nächsten Ausgabe…
Nach unserer Umbaupause zwecks Unternehmensgründung sind wir wieder mit spannenden Themen des Selbstmanagements für Sie da. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bis dahin treu bleiben.
Sprachhinweis / Vollständiger Haftungsausschluss / Provisionshinweis
Wir verwenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung in der Regel das generische Maskulinum, gemeint sind damit immer Angehöriger aller Geschlechter.
Die Inhalte unserer Newsletter und unserer Internetseiten dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Beratungsleistung dar und ersetzen keine medizinische, psychologische oder anderweitig ggf. notwendige professionelle Beratung, Betreuung oder Therapie. Wir stellen sämtliche Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung. Wir übernehmen allerdings keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Risikolosigkeit der von uns bereitgestellten Informationen. Ebenso schließen wir jegliche Haftung für die Folgen der Nutzung der von uns zur Verfügung gestellten Informationen aus. Unsere Empfehlungen ersetzen keine Arztbesuche, psychologische Betreuung oder anderweitige professionelle Hilfe bei medizinischen, psychologischen oder anderweitigen Problemen. Sie sollten die Informationen in unserem Newsletter und auf unseren Internetseiten nicht zur Selbstdiagnose verwenden oder aufgrund der Informationen auf medizinische, psychologische oder anderweitige professionelle Beratung oder Betreuung verzichten. Suchen Sie stets professionellen Rat, bevor Sie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, oder sonstige Substanzen außerhalb gewöhnlicher Lebensmittel zu sich nehmen. Lassen Sie sich sportärztlich untersuchen, bevor Sie größere, ungewohnte körperliche Belastungen auf sich nehmen. Mit der Nutzung unserer Internetseiten und/oder dem Abonnement unserer Newsletter erklären Sie ausdrücklich, dass Sie keinerlei Haftungsansprüche gegen uns geltend machen werden.
Wenn wir über Produkte berichten und auf Händlerseiten verlinken, kann es sein, dass wir für einen eventuellen Kauf eine Provision erhalten. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Wir bemühen uns vielmehr, Rabatte für unsere Leserinnen und Leser zu verhandeln, wo immer das möglich ist. Wir berichten nur über solche Produkte, die wir selbst sorgfältig bewertet haben oder über die wir aus glaubwürdigen Quellen positive Bewertungen vorliegen haben.